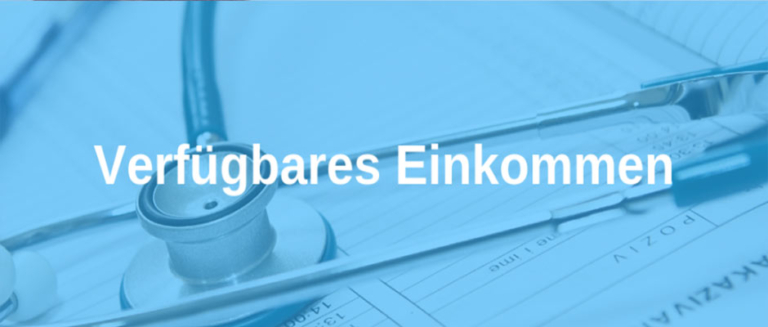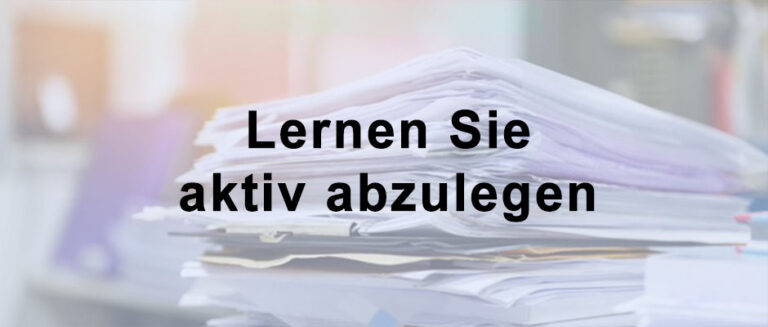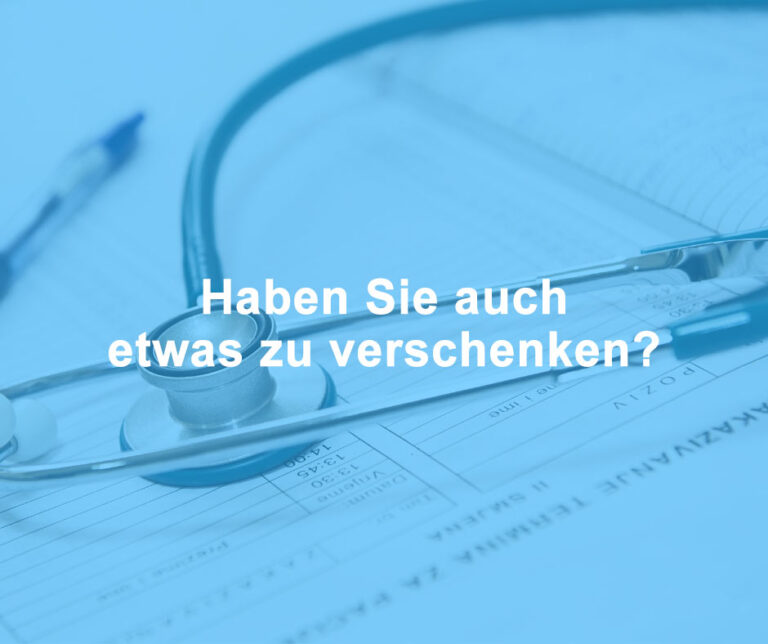Patientenfrequenzen

Wenn die Einkommen nach oben begrenzt sind, dann kommt der Kostenreduktion eine enorme Bedeutung zu. Ohne eine gut funktionierende Praxisorganisation ist ein kostengünstiges Haushalten gar nicht möglich. Zwei weitere Beispiele aus meiner Beratung werden Ihnen das zeigen.
„Sie sehen anhand der Statistiken ja selber, was bei uns los ist. Wie sollen wir denn den Patientenansturm anders bewältigen, als mehr Personal einzustellen? Andererseits können wir uns aber mehr Personal gar nicht leisten.“